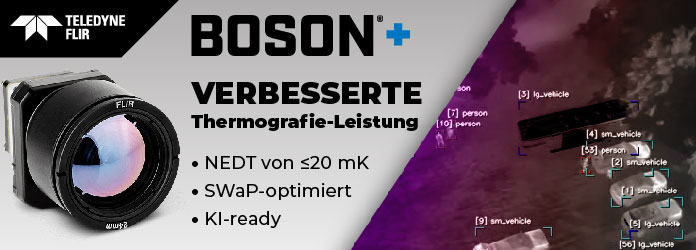Zwischenruf aus Berlin – Pistorius‘ Kampfkurve
Hans-Peter Bartels
Ganz am Ende der diesjährigen Bundeswehrtagung, in der Abschlussrede des Verteidigungsministers kam auf Seite 30 (von 32 Seiten Vortragstext) noch ein wirklich wesentlicher big point. Boris Pistorius kündigte am 10. November vor der versammelten Bundeswehrführung nun doch das an, was er bis dahin eher hatte vermeiden wollen: die große Strukturreform der Streitkräfte.
Er habe Generalinspekteur Carsten Breuer und Staatssekretär Nils Hilmer beauftragt, „bis Ostern 2024 Vorschläge zu einer neuen Struktur der Streitkräfte und der nachgeordneten zivilen Bereiche vorzulegen“. Dabei solle es „explizit keine Denkverbote“ geben, „existierende Organisationsbereiche“ und „bestehende Kommandos“, sagte Pistorius, dürften und müssten „hinterfragt“ werden.
Damit kommt der Minister auf die „Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft“ zurück, die der frühere Generalinspekteur Eberhard Zorn im Auftrag von Pistorius’ Vorvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Mai 2021 vorgelegt hatte. Deren Maxime lautete: „weniger Stäbe, mehr Truppe“. Die einstmals zu Sparzwecken eingeführten zentralisierten Organisationsbereiche Streitkräftebasis und Sanitätsdienst sollten ihre Eigenständigkeit verlieren und wieder den Teilstreitkräften zugeordnet werden. Aber auch die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine und der Cyberbereich sollten schlankere Strukturen einnehmen. Gegen die Misere der Materialerhaltung wurden TSK-spezifische „Systemhäuser“ vorgeschlagen.
Der Regierungswechsel 2021 stoppte zunächst dieses – längst überfällige – Reformvorhaben. Ministerin Christine Lambrecht, der selbst aus persönlicher Befassung noch keinerlei substanzielle Bundeswehr-Probleme bekannt waren, gab 2022 erst einmal eine „kritische Bestandsaufnahme“ in Auftrag. Auch deren, eher kleinteilige, Schlussfolgerungen könnten jetzt in die Pistorius-Reform 2024 einfließen. Dazu kommen bereits begonnene Umgliederungen im Heer oder etwa Pilotprojekte in der Marine. Der Cyberbereich hat sich bereits verschlankt.
Mit seinem befreiungsschlagartigen Bekenntnis zur umfassenden Reform hat sich Minister Pistorius von früheren Abwehrreflexen verabschiedet, etwa von dem Satz, „in voller Fahrt, die wir gerade aufnehmen, an dem Schiff rumzubauen, neue Segel aufzuziehen und den Käpt‘n zu wechseln, ist keine gute Idee“. So wie es erwiesenermaßen eine gute Idee war, den Käpt‘n zu wechseln, so ist auch die Streitkräftereform die notwendige Voraussetzung für die Wiederherstellung der Fähigkeit zur Teilnahme an der kollektiven Verteidigung mit der ganzen Bundeswehr.
In den ebenfalls auf der Bühne der Bundeswehrtagung vorgestellten „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ heißt es sehr richtig, dass heute „zeitgemäße Landes- und Bündnisverteidigung für die Bundeswehr strukturbestimmend“ sei. Es gehe darum, „Entscheidungs- und Verantwortungskompetenz auf jeder Ebene“ zu stärken, „Redundanzen abzubauen, unklare Schnittstellen zu beseitigen und insgesamt schlanker in den Strukturen zu werden“. Die VPR wenden sich gegen „künstlich aufgeteilte Zuständigkeiten“ und „Verantwortungsdiffusion“.
Mit ähnlicher Stoßrichtung hatten Generalleutnant a. D. Rainer Glatz und ich 2020 in einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) unter dem Titel „Welche Reform die Bundeswehr heute braucht“ formuliert: „Der Grundsatz, Verantwortung, Kräfte und Mittel in eine Hand zu geben, ist oberstes Gebot.“
Als Superzeichen der verteidigungspolitischen Zeitenwende verwenden die neuen Richtlinien wie auch der Minister in seinen öffentlichen Reden jetzt gelegentlich den Begriff der „Kriegstüchtigkeit“. Damit ist Ärger programmiert, aber er rüttelt auf.
Wie sich durch das „Weißbuch“ von 2016 das Wort „Resilienz“ als Leitmotiv zieht, so ist es in den neuen VPR die reaktivierte Kalte-Kriegs-Vokabel „Gesamtverteidigung“. Denn bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit geht es in Zukunft nicht mehr allein um die Amtshilfe-Beiträge der Bundeswehr in zivilen Notlagen, sondern neuerdings auch wieder um die Aufgaben von Behörden, Wirtschaft und Gesellschaft im militärischen Ernstfall. Gerade erarbeitet die Bundesregierung in Abstimmung mit den Bundesländern ein „Konzept Gesamtverteidigung“; die Federführung dafür liegt bei Innenministerin Nancy Faeser.
Lange angekündigt und auf der Bundeswehrtagung in Berlin abgeliefert ist eine Organisationsreform des Verteidigungsministeriums selbst. Das neue Organigramm weist statt bisher 29 nur noch 26 Unterabteilungen für die weiterhin 10 Ministeriumsabteilungen aus. Was genau damit gewonnen wird, erscheint allerdings noch etwas unklar. Jedenfalls sollen zehn Prozent der Dienstposten des BMVg in nachgeordnete Bereiche verlagert werden. Vor allem Planung und Rüstung geben Kompetenzen ab. Die Politikabteilung mit einem bewährten Karrierediplomaten an der Spitze bleibt eine Art Außenposten des Auswärtigen Amtes im Bendlerblock, jetzt noch angereichert durch Zuständigkeiten für Rüstungspolitik und Rüstungsexport. Personalentscheidungen für Spitzenpositionen waren vorerst mit dem Umbau im eigenen Haus nicht verbunden.
Auch in Sachen Geld hat der November bemerkenswerte Bekenntnisse gebracht. Bundeskanzler Olaf Scholz erneuerte auf der Bundeswehrtagung und bei den Beratungen im Parlament seine Zusage, wie in der NATO vereinbart kontinuierlich zwei Prozent (oder mehr) der deutschen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzuwenden. Diese Rechnung dürfte 2024 zum ersten Mal aufgehen, wenn man die (verdoppelte) Militärhilfe für die Ukraine und verteidigungsbezogene Zinsverpflichtungen (erstmals) einrechnet.
Dann sind 2,0 oder sogar 2,1 Prozent möglich – vorausgesetzt, es gelingt wie geplant, 20 Milliarden Euro aus dem Bundeswehr-„Sondervermögen“ (plus drei Milliarden aus dem regulären Etat) für Beschaffungen tatsächlich abfließen zu lassen. Ob in diesem Jahr der haushalterische Beschaffungsrahmen voll ausgeschöpft wird, scheint einmal mehr fraglich.
Letztes Jahr blieben zwei Milliarden Euro liegen. Der Mittelabfluss ist das Nadelöhr.
Wie es nach Ausschöpfung des Sondervermögens ab 2028 weitergeht, bleibt vorerst im Dunkeln. Die finanzielle Größenordnung, um die zu ringen ist, eine Anhebung des regulären Verteidigungsbudgets um jährlich 30 Milliarden Euro, hat der Bundeskanzler immerhin schon einmal angedeutet. Der dauerhafte Zwei-Prozent-Etat wäre sicher leichter zu erreichen, wenn schon ab 2025 der Verteidigungshaushalt in Schritten von vielleicht jeweils fünf oder sieben Milliarden Euro dem neuen verpflichtenden Niveau entgegenwachsen (und das Sondervermögen dafür etwas langsamer ausgeschöpft) würde.
Jedenfalls müssen die Haushaltseckpunkte des Kabinetts, die im März erwartet werden, mit der Mittelfristigen Finanzplanung Hinweise darauf geben, welchen Weg die gegenwärtige Regierung für gangbar hält. Mit dem Verfassungsgerichts-Veto gegen die Umwidmung ungenutzter Corona-Sondermittel für Zwecke des Klimaschutzes dürfte jedoch der Kampf ums Geld noch an Dramatik gewonnen haben.
Für Verteidigungsminister Boris Pistorius, der nach wie vor der beliebteste Politiker Deutschlands ist, war dieser November der Monat, in dem er die Kurve bekommen hat.
Sein Projekt Litauen-Brigade, die Beschwörungen der Planungssicherheit in künftigen Haushaltsjahren, die (nachholenden) Verteidigungspolitischen Richtlinien, auch das Klein-Klein des BMVg-Umbaus und die neue „Kriegstüchtigkeits“-Rhetorik markieren zweifellos jeweils Fortschritte, zumal in der Summe. Entscheidend aber wird die Strukturreform der Streitkräfte sein. Gut, dass Pistorius jetzt bereit ist, sich über falsche Ratschläge und Widerstände hinwegzusetzen. Spät, aber hoffentlich nicht zu spät.
Hans-Peter Bartels